
| Aktuelles | Grundlagen | Erprobungspläne | Ergebnisse | Kontakte | Diskussionsforum | |
 |
|
Fachliche und didaktische Grundlagen
"Die Mittelschule ist eine differenzierte Schulart. Sie vermittelt eine allgemeine und berufsvorbereitende Bildung und schafft Voraussetzungen für eine berufliche Qualifizierung." (Schulgesetz des Freistaates Sachsen)
In Vorbereitung auf die Entwicklung einer tragfähigen Konzeption für den Profilbereich der Mittelschule wurden unterschiedlichste Literaturquellen ausgewertet, die Ergebnisse des BLK-Modellversuchs "Die Mittelschule im Freistaat Sachsen" aufbereitet, Gespräche mit Lehrern an beruflichen Schulzentren und Mittelschulen geführt, Vertreter von Klein-, Mittel- und Großbetrieben befragt, Diskussionen mit direkt und indirekt Betroffenen geführt. Im Ergebnis stehen vielfältige Erwartungen und Forderungen, die die besondere Bedeutung des Profilbereichs der sächsischen Mittelschule für die Lebens- und Arbeitsweltvorbereitung unterstreichen.
Um eine sachbezogene Diskussion mit allen Beteiligten führen zu
können, wurden
![]() Standards für den Profilbereich der Mittelschule
entwickelt. Sie stellen gleichzeitig eine Leistungsniveaubeschreibung für
den mittleren Bildungsabschluss bezüglich der Gegenstandsbereiche
Wirtschaft, Haushalt, Technik und Beruf dar.
Standards für den Profilbereich der Mittelschule
entwickelt. Sie stellen gleichzeitig eine Leistungsniveaubeschreibung für
den mittleren Bildungsabschluss bezüglich der Gegenstandsbereiche
Wirtschaft, Haushalt, Technik und Beruf dar.
Aufgaben der lebens- und arbeitsweltvorbereitenden Bildung
Die Fähigkeit und Bereitschaft, das eigene Leben in privaten, öffentlich-gesellschaftlichen und berufsvorbereitenden Situationen verantwortlich und kompetent zu gestalten, ist in einem kontinuierlichen Prozess auf der Basis eines altersgemäßen und subjektorientierten Lernhandelns zu entwickeln.
Unter Beachtung der dynamischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen im Freistaat Sachsen, aber auch in Europa, leiten sich für die Mittelschule generelle Zielstellungen ab:
|
|
Vermittlung einer soliden und anwendungsbereiten allgemeinen Bildung |
|
|
Realisierung eines handlungs- und praxisorientierten Lernens |
|
|
Unterbreitung eines flexiblen, attraktiven Bildungsangebotes |
|
|
Förderung von individuellen Begabungen und Neigungen |
Damit ergeben sich für diese Schulart übergeordnete Ausbildungsziele und spezifische Methoden, die die enge Anbindung von Inhalten der Lebens- und Arbeitswelt an tradierte Unterrichtsinhalte erforderlich machen.
Der Profilbereich der Mittelschule muss die komplexen Entwicklungen in der Gesellschaft und Wirtschaft berücksichtigen. Er hat das Ziel, auf der Grundlage einer handlungsorientierten und praxisnahen Gestaltung grundlegende und individuelle Kompetenzen durch eine mehrperspektivische Betrachtungsweise auf die Gegenstände und Erscheinungen der Lebenswelt zu vermitteln bzw. auszuprägen. Inhaltlich, strukturell und organisatorisch muss die Arbeit im Profilbereich die Grenzen der üblichen Fachsystematik überschreiten, um vernetztes Denken zu entwickeln.
Von besonderer Bedeutung sind dabei folgende Aspekte:
|
|
Vermittlung wirtschaftlicher, sozialer, haushälterischer und technischer Inhalte in übergreifender Betrachtungsweise |
|
|
Anwendung von Arbeitsformen zur Bearbeitung komplexer Themen, die eine erhöhte Verantwortung erfordern und zunehmend stärkere Selbstorganisation und Eigeninitiative verlangen |
|
|
Entdeckung und Entwicklung von Neigungen und Interessen im Hinblick auf eine selbstbestimmte Gestaltung der Berufs- und Lebensplanung |
|
|
Erweiterung und Qualifizierung schulischer Angebote durch Nutzung regionaler Kooperationsmöglichkeiten |
Struktur
der Ausbildung im Profilbereich der Mittelschule
Die Realisierung der zentralen Aufgaben der lebens- und arbeitsweltorientierten
Bildung erfolgt in den drei Bereichen
![]() Grundlagen,
Grundlagen,
![]() Neigungen
und
Neigungen
und
![]() Spezialisierungen,
deren inhaltliche Vernetzung durch die folgenden Zielsetzungen deutlich werden
soll:
Spezialisierungen,
deren inhaltliche Vernetzung durch die folgenden Zielsetzungen deutlich werden
soll:
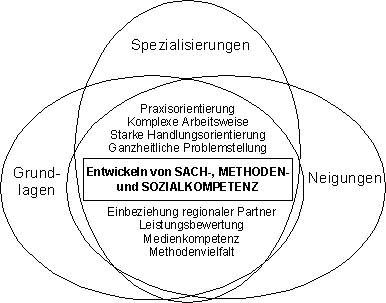
Die Bestimmung der Funktion und Zielsetzung der einzelnen Bereiche kann durch ausgewählte Indikatoren erfolgen:
Zielsetzung
|
Lerninhalte
|
Planung
|
Leistungsbewertung
|
Die Ausbildung in den unterschiedlichen Bereichen soll auf der Basis einer Konzeption erfolgen. Grundlegende Anliegen sind dabei:
|
|
Die Ziele und Inhalte werden durch das Kompetenzmodell, das auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungsfähigkeit fokussiert ist, bestimmt. |
|
|
Die Ausbildung zielt auf die Befähigung der Schüler zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Kernproblemen in den lebens- und arbeitsweltbezogenen Handlungsfeldern. |
|
|
Der Profilbereich fördert und fordert fächerübergreifendes Arbeiten. |
|
|
Die Erprobungspläne beschreiben Leistungsanforderungen und ermöglichen Gestaltungsspielräume. |
Kompetenzentwicklung
und fächerübergreifendes Arbeiten
Allgemein bildende Schulen, insbesondere die Mittelschule mit ihren
Bildungsgängen, müssen dazu beitragen, dass die Schüler in
aktuellen und zukünftigen Lebenssituationen bewusst, selbstständig
und eigenverantwortlich handeln. Konkrete gesellschaftliche Erwartungshaltungen
an Mittelschule und deren Absolventen erwachsen insbesondere aus dem Leitbild
der umfassenden Handlungsfähigkeit. Im zu Grunde liegenden Kompetenzmodell
hat sie integrative Funktion. Sie wird determiniert durch Sach-, Methoden-
und Sozialkompetenz.
|
|
Sachkompetenz ... umfasst die Fähigkeit, angeeignetes Wissen und Können sowie erworbene Fertigkeiten in Handlungszusammenhängen adäquat bzw. sachgerecht anzuwenden, Gelerntes sowie gewonnene Einsichten zu verknüpfen und sachbezogen zu urteilen. |
|
|
Methodenkompetenz ... umfasst die Fähigkeit, auf Grund erworbener Arbeits- und Lerntechniken Aufgaben und Probleme zu erkennen und zu analysieren, Lösungsvorschläge und -alternativen situationsbezogen zu entwickeln, einen Lösungsweg begründet auszuwählen und durchzuführen sowie das Ergebnis sachgerecht zu beurteilen. |
|
|
Sozialkompetenz ... umfasst die Fähigkeit, sozialintegrativ und verantwortungsbewusst zu interagieren, eigene Stärken und Schwächen einzuschätzen sowie verantwortungsvoll einzusetzen, Emotionales und Rationales ausgewogen zu berücksichtigen, sich der Notwendigkeit als verantwortlich Handelnder bewusst zu sein und sich werteorientiert zu verhalten. |
Mit dem Kompetenzmodell wird der Lernprozess in seiner Mehrdimensionalität erfasst, d. h. fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ. Damit ist die Möglichkeit gegeben, das Lernen im Profilbereich und aus der Sicht fachübergreifender Zielstellungen zu beschreiben.
Die Orientierung auf die Entwicklung von Kompetenzen führt weg von einseitiger Stofforientierung hin zu verantwortungsvollem, schöpferischem Ausgestalten von Lernsituationen.
Kompetenzen entwickeln sich nicht losgelöst voneinander und sind in der Regel an konkrete Gegenstände, Handlungen, Fähigkeiten und Erfahrungen gebunden. Sie bedingen einander, durchdringen und ergänzen sich gegenseitig und werden in der tätigen Auseinandersetzung erworben.
Unterricht vom Kompetenzbegriff her zu denken und umzusetzen bedeutet:
|
|
die Schüler als Subjekte in einem zunehmend
selbstorganisierten Lernprozess tätig werden zu lassen, d. h.
|
||||||||||||
|
|
konkrete Ziele und Inhalte stets dahingehend zu hinterfragen,
inwieweit sie geeignet sind,
|
|
© 1999 |
Sächsisches Staatsinstitut für
Bildung und Schulentwicklung |