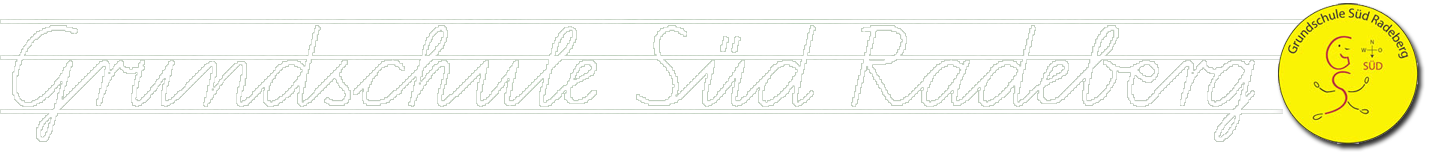
UNSER SCHULPROGRAMM
Vorbemerkungen
Unser neues Schulprogramm soll ein Arbeits- und Steuerungsinstrument der Schule sein und den Entwicklungsprozess zur Verbesserung schulischer Qualität unterstützen.
Wenn wir etwas verändern wollen, sollte der Wunsch nach Veränderung schon in uns sein.
Schon Benjamin Franklin sagte, dass es drei Arten von Menschen gäbe:
⦁ solche, die unbeweglich sind,
⦁ solche, die beweglich sind,
⦁ und solche, die sich bewegen.
Wir, die Lehrer der Grundschule Süd, wollen uns weiterbewegen und die besonderen Merkmale didaktisch methodischen Handelns umsetzen und weiterentwickeln.
Vorbemerkungen
Unser neues Schulprogramm soll ein Arbeits- und Steuerungsinstrument der Schule sein und den Entwicklungsprozess zur Verbesserung schulischer Qualität unterstützen.
Wenn wir etwas verändern wollen, sollte der Wunsch nach Veränderung schon in uns sein.
Schon Benjamin Franklin sagte, dass es drei Arten von Menschen gäbe:
⦁ solche, die unbeweglich sind,
⦁ solche, die beweglich sind,
⦁ und solche, die sich bewegen.
Wir, die Lehrer der Grundschule Süd, wollen uns weiterbewegen und die besonderen Merkmale didaktisch methodischen Handelns umsetzen und weiterentwickeln.
Unser Leitbild
Die Leitvorstellungen unserer Schule dienen dazu, das Selbstverständnis und die Grundorientierungen der pädagogischen Arbeit als fortwährende Aufgabe aller Beteiligten zu verdeutlichen und unsere Arbeit an ihnen zu orientieren.
Es bildet die Basis im Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern, unseren Kooperationspartnern und dem Lehrerteam.
Dieses Verhältnis soll von Respekt , Vertrauen und Wertschätzung geprägt sein und ist Voraussetzung für ein positives Schulklima.
Die Leitvorstellungen unserer Schule dienen dazu, das Selbstverständnis und die Grundorientierungen der pädagogischen Arbeit als fortwährende Aufgabe aller Beteiligten zu verdeutlichen und unsere Arbeit an ihnen zu orientieren.
Es bildet die Basis im Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern, unseren Kooperationspartnern und dem Lehrerteam.
Dieses Verhältnis soll von Respekt , Vertrauen und Wertschätzung geprägt sein und ist Voraussetzung für ein positives Schulklima.


DER UNTERRICHT



Ziel des Unterrichts
● Der Unterricht ist wichtigster Bestandteil der Schulkonzeption.
● Ziel ist es, dass alle Schüler während ihrer Grundschulzeit ein strukturiertes und anschlussfähiges Wissen, eigene Wertevorstellungen und Kompetenzen erwerben.
● Politische Bildung, Medienbildung und Digitalisierung sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung sind besonders bedeutsam für unsere Unterrichtsarbeit.
● In den ersten Wochen der Klasse 1 übernimmt der Klassenleiter den Unterricht. Er schafft die Grundlagen für die Basis des Lernens. Dabei stehen Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten im Fokus.
QUALITÄTSSICHERUNG SCHULEINGANGSPHASE
● Der Unterricht ist wichtigster Bestandteil der Schulkonzeption.
● Ziel ist es, dass alle Schüler während ihrer Grundschulzeit ein strukturiertes und anschlussfähiges Wissen, eigene Wertevorstellungen und Kompetenzen erwerben.
● Politische Bildung, Medienbildung und Digitalisierung sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung sind besonders bedeutsam für unsere Unterrichtsarbeit.
● In den ersten Wochen der Klasse 1 übernimmt der Klassenleiter den Unterricht. Er schafft die Grundlagen für die Basis des Lernens. Dabei stehen Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten im Fokus.
QUALITÄTSSICHERUNG SCHULEINGANGSPHASE
Grundanliegen des Unterrichts
● Angebot vielfältiger Unterrichtsformen, um individuelles und kooperatives Lernen zu ermöglichen
● Individualisierung und differenzierte Unterrichtsgestaltung, deshalb kein durchgängiger Frontalunterricht mehr



Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit
1. Unterrichtsformen an unserer Grundschule
● Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
● Werkstattunterricht
● Wochenplanarbeit
● Freie Arbeit
● Frontale Arbeitsphasen
● Lernen an Stationen (Lerntheken)
2. Verfahren zum Erlernen der Schriftsprache im Anfangsunterricht (Kl. 1/ 2)
● das analytisch- synthetische Verfahren mit ganzheitlicher Ergänzung
● das Verfahren „Lesen durch Schreiben“



● Fachübergreifendes Arbeiten ist Prinzip an unserer Schule.
● Fächerverbindendes Lernen soll erweitert werden und in den nächsten Jahren ebenso verbindlich in den Unterricht integriert werden.
● Unsere Schulprojektwoche bildet bereits einen Teil davon.
● Auch einzelne „Projekte“ in den Klassen sind bereits zu einer attraktiven, leistungsfähigen Unterrichtsmethode geworden.
1. Unterrichtsformen an unserer Grundschule
● Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
● Werkstattunterricht
● Wochenplanarbeit
● Freie Arbeit
● Frontale Arbeitsphasen
● Lernen an Stationen (Lerntheken)
2. Verfahren zum Erlernen der Schriftsprache im Anfangsunterricht (Kl. 1/ 2)
● das analytisch- synthetische Verfahren mit ganzheitlicher Ergänzung
● das Verfahren „Lesen durch Schreiben“



● Fachübergreifendes Arbeiten ist Prinzip an unserer Schule.
● Fächerverbindendes Lernen soll erweitert werden und in den nächsten Jahren ebenso verbindlich in den Unterricht integriert werden.
● Unsere Schulprojektwoche bildet bereits einen Teil davon.
● Auch einzelne „Projekte“ in den Klassen sind bereits zu einer attraktiven, leistungsfähigen Unterrichtsmethode geworden.



LRS- eine besondere Förderung
● Seit 1995 ist die GS Süd Stützpunktschule für Kinder mit Lese- Rechtschreibstörungen.
● Die Beschulung in einer LRS- Klasse dauert 2 Jahre.
● ab Kl. 4 Wiedereingliederung in Regelklasse
● ausgewählte Methoden wie z.B. Kieler- Lese- und Rechtschreibaufbau
Ziel dieser Förderung:
● Umgang mit dieser „Schwäche“ lernen
● Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten ausschöpfen
2. Verfahren zum Erlernen der Schriftsprache im Anfangsunterricht (Kl. 1/ 2)
● das analytisch- synthetische Verfahren mit ganzheitlicher Ergänzung
● das Verfahren „Lesen durch Schreiben“


● Fachübergreifendes Arbeiten ist Prinzip an unserer Schule.
● Fächerverbindendes Lernen soll erweitert werden und in den nächsten Jahren ebenso verbindlich in den Unterricht integriert werden.
● Unsere Schulprojektwoche bildet bereits einen Teil davon.
● Auch einzelne „Projekte“ in den Klassen sind bereits zu einer attraktiven, leistungsfähigen Unterrichtsmethode geworden.
● Teilnahme am Projekt "Gemüseackerdemie"
● Seit 1995 ist die GS Süd Stützpunktschule für Kinder mit Lese- Rechtschreibstörungen.
● Die Beschulung in einer LRS- Klasse dauert 2 Jahre.
● ab Kl. 4 Wiedereingliederung in Regelklasse
● ausgewählte Methoden wie z.B. Kieler- Lese- und Rechtschreibaufbau
Ziel dieser Förderung:
● Umgang mit dieser „Schwäche“ lernen
● Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten ausschöpfen
2. Verfahren zum Erlernen der Schriftsprache im Anfangsunterricht (Kl. 1/ 2)
● das analytisch- synthetische Verfahren mit ganzheitlicher Ergänzung
● das Verfahren „Lesen durch Schreiben“


● Fachübergreifendes Arbeiten ist Prinzip an unserer Schule.
● Fächerverbindendes Lernen soll erweitert werden und in den nächsten Jahren ebenso verbindlich in den Unterricht integriert werden.
● Unsere Schulprojektwoche bildet bereits einen Teil davon.
● Auch einzelne „Projekte“ in den Klassen sind bereits zu einer attraktiven, leistungsfähigen Unterrichtsmethode geworden.
● Teilnahme am Projekt "Gemüseackerdemie"
Wie setzen wir die Zielstellung unseres Unterrichts um?
Individualisierung und Differenzierung im Unterricht:
Individualisierung und Differenzierung im Unterricht:
● Binnendifferenzierung im Unterricht (Angebot verschiedener Schwierigkeitsstufen, Wahlaufgaben)
● Förderunterricht (auch als GTA z.B. Yoga, Ergotherapie, Computer möglich)
● Leseprogramm Antolin
● Lernstandsdiagnose (Erstellen individueller Förderpläne)
Kooperatives Lernen:
● Patenschaften mit jüngeren Schülern (z.B. Klasse 1 und 3)
● Patenschaften innerhalb der Klasse (leistungsstarke Schüler helfen leistungsschwächeren)
Teilnahme an Wettbewerben:
● Känguruwettbewerb (Mathematik Kl. 3/ 4)
● Lesewettbewerb
● Sächsischer Jugendjournalistenpreis
● Rosso- Majores- Wettbewerb (Kunst)
● Sportwettkämpfe (Ball über die Leine, Kl. 3; Völkerballturnier, Kl.4)
● Förderunterricht (auch als GTA z.B. Yoga, Ergotherapie, Computer möglich)
● Leseprogramm Antolin
● Lernstandsdiagnose (Erstellen individueller Förderpläne)
Kooperatives Lernen:
● Patenschaften mit jüngeren Schülern (z.B. Klasse 1 und 3)
● Patenschaften innerhalb der Klasse (leistungsstarke Schüler helfen leistungsschwächeren)
Teilnahme an Wettbewerben:
● Känguruwettbewerb (Mathematik Kl. 3/ 4)
● Lesewettbewerb
● Sächsischer Jugendjournalistenpreis
● Rosso- Majores- Wettbewerb (Kunst)
● Sportwettkämpfe (Ball über die Leine, Kl. 3; Völkerballturnier, Kl.4)
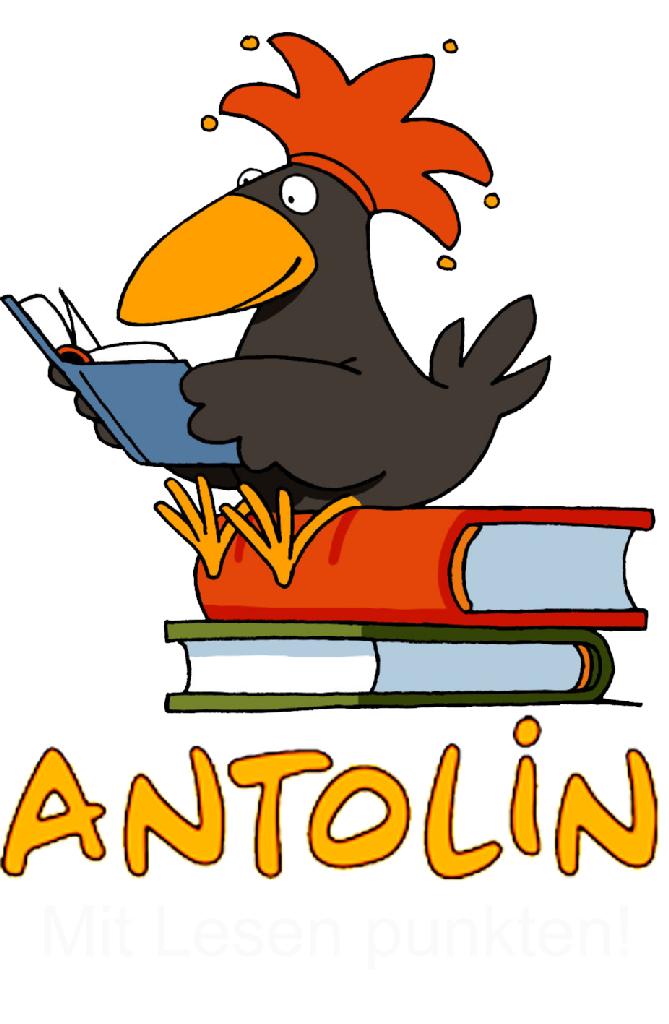



Lehrer kooperieren miteinander
„Es fällt viel Arbeit an – wir teilen sie uns“
Wir finden gemeinsames Arbeiten gut. Deshalb entwickeln wir unsere Projekte gemeinsam weiter, nutzen dabei verschiedene Formen des Austauschs und der Zusammenarbeit.
Wir arbeiten in verschiedenen Gremien
1. Lehrerkonferenz
Lehrer und bei Bedarf auch Vertreter des Elternrats klären grundlegende Themen der Schule
2. Schulkonferenz
Mindestens einmal im Halbjahr treffen sich gewählte Vertreter des Elternrates und des Lehrerkollegiums, um wichtige Maßnahmen für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule zu besprechen
„Es fällt viel Arbeit an – wir teilen sie uns“
Wir finden gemeinsames Arbeiten gut. Deshalb entwickeln wir unsere Projekte gemeinsam weiter, nutzen dabei verschiedene Formen des Austauschs und der Zusammenarbeit.
Wir arbeiten in verschiedenen Gremien
1. Lehrerkonferenz
Lehrer und bei Bedarf auch Vertreter des Elternrats klären grundlegende Themen der Schule
2. Schulkonferenz
Mindestens einmal im Halbjahr treffen sich gewählte Vertreter des Elternrates und des Lehrerkollegiums, um wichtige Maßnahmen für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule zu besprechen

3. Jahrgangs- und Fachkonferenzen
Lehrer der einzelnen Jahrgänge besprechen Themen ihrer Klassenstufe und bereiten einige Unterrichtsthemen gemeinsam vor.
Der Austausch und das Bereitstellen von Materialien und Ideen soll sich dabei zu einer selbstverständlichen Basis entwickeln.
Förderlehrer besprechen regelmäßig mit den Klassenlehrern die nächsten Lernziele der Förderkinder.
Lehrer der einzelnen Jahrgänge besprechen Themen ihrer Klassenstufe und bereiten einige Unterrichtsthemen gemeinsam vor.
Der Austausch und das Bereitstellen von Materialien und Ideen soll sich dabei zu einer selbstverständlichen Basis entwickeln.
Förderlehrer besprechen regelmäßig mit den Klassenlehrern die nächsten Lernziele der Förderkinder.
4. Klassenkonferenz
Klassenlehrer, Fachlehrer und eventuell die Elternvertreter einer Klasse treffen Absprachen (z.B. Kopfnoten, besondere Fördermaßnahmen, Notengebung, Bildungsempfehlungen…)
5. Dienstberatung
mindestens einmal im Monat
Lehrer und Schulleitung besprechen intensiv pädagogische Themen und Belange des schulischen Alltags
Klassenlehrer, Fachlehrer und eventuell die Elternvertreter einer Klasse treffen Absprachen (z.B. Kopfnoten, besondere Fördermaßnahmen, Notengebung, Bildungsempfehlungen…)
5. Dienstberatung
mindestens einmal im Monat
Lehrer und Schulleitung besprechen intensiv pädagogische Themen und Belange des schulischen Alltags



Wir arbeiten in verschiedenen Teams
1. Team Leserechtschreibschwäche (LRS)
● Klassenlehrer der LRS-Klassen planen ihren Unterricht gemeinsam und tauschen ihr Material untereinander aus
● regelmäßige Beratungsgespräche mit Eltern betroffener Schüler
● Durchführung von Weiterbildungen für interessierte KollegInnen und SchulleiterInnen
● jährliches LRS-Feststellungsverfahren
● Förderhinweise für jeden Schüler mit einer LRS zur weiteren Beschulung in Regelklassen
1. Team Leserechtschreibschwäche (LRS)
● Klassenlehrer der LRS-Klassen planen ihren Unterricht gemeinsam und tauschen ihr Material untereinander aus
● regelmäßige Beratungsgespräche mit Eltern betroffener Schüler
● Durchführung von Weiterbildungen für interessierte KollegInnen und SchulleiterInnen
● jährliches LRS-Feststellungsverfahren
● Förderhinweise für jeden Schüler mit einer LRS zur weiteren Beschulung in Regelklassen


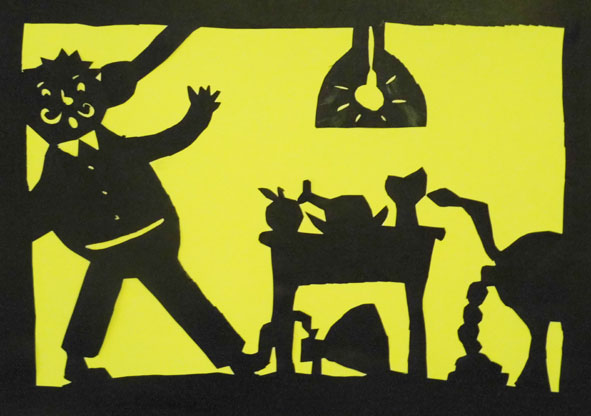
2. Team Schulvorbereitung
● Eine Beratungslehrerin führt in die Schulvorbereitung durch
● Organisation der Kooperation zwischen der Grundschule Süd und ausgewählter Kindergärten der zukünftigen Schulanfänger
● Gestaltung von „Schnupperstunden“ für alle neuen Erstklässler
● Besuche in verschiedenen Kindergärten, Einladungen zu schulischen Veranstaltungen
● Durchführung Schuleingangstest
3. Team Ganztagsangebote (GTA)
● Planen und Organisieren des reibungslosen Ablaufs der GTA
● regelmäßiger Kontakt zu den GTA Leitern, 2x im Schuljahr Treffen der GTA Leiter
● Beantragen von Geldern und Zuschüssen bei den entsprechenden Stellen
4. Team Lesewettbewerb
● Rund um den Welttag des Buches findet ein Projekttag zum Thema „Lesen“ in den Klassen statt. Der darin enthaltene Schullesewettbewerb gehört zu einer guten Tradition und wird von zwei KollegInnen vorbereitet.
5. Team Projektwoche
● einmal im Jahr klassenstufenübergreifende Projektwoche
● Schaffung von Rahmenbedingungen und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs
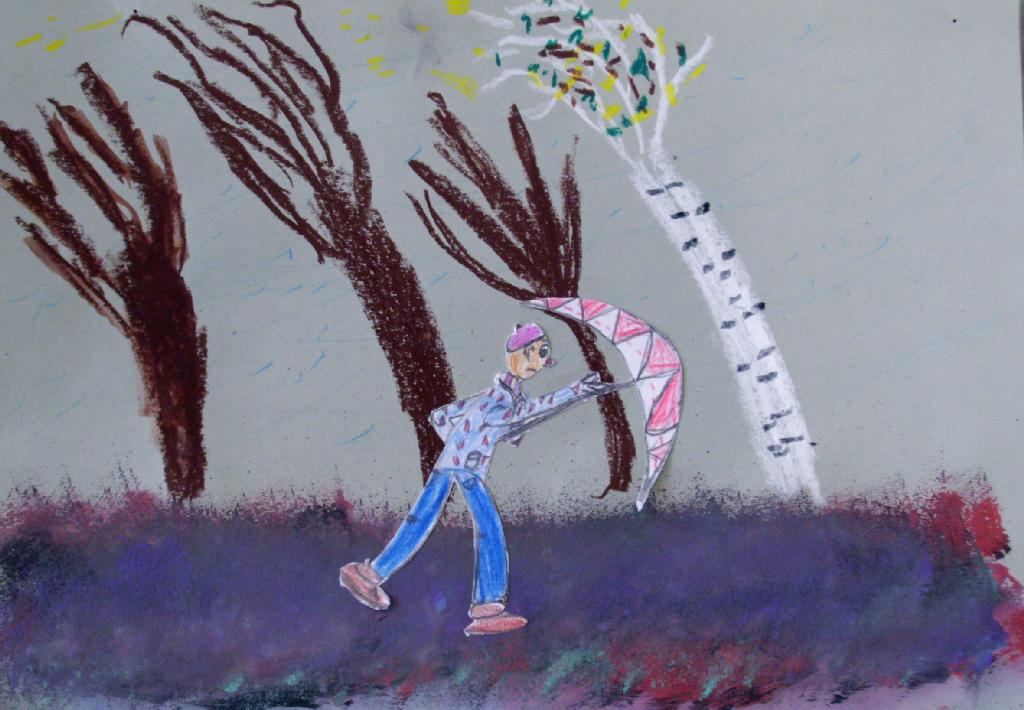

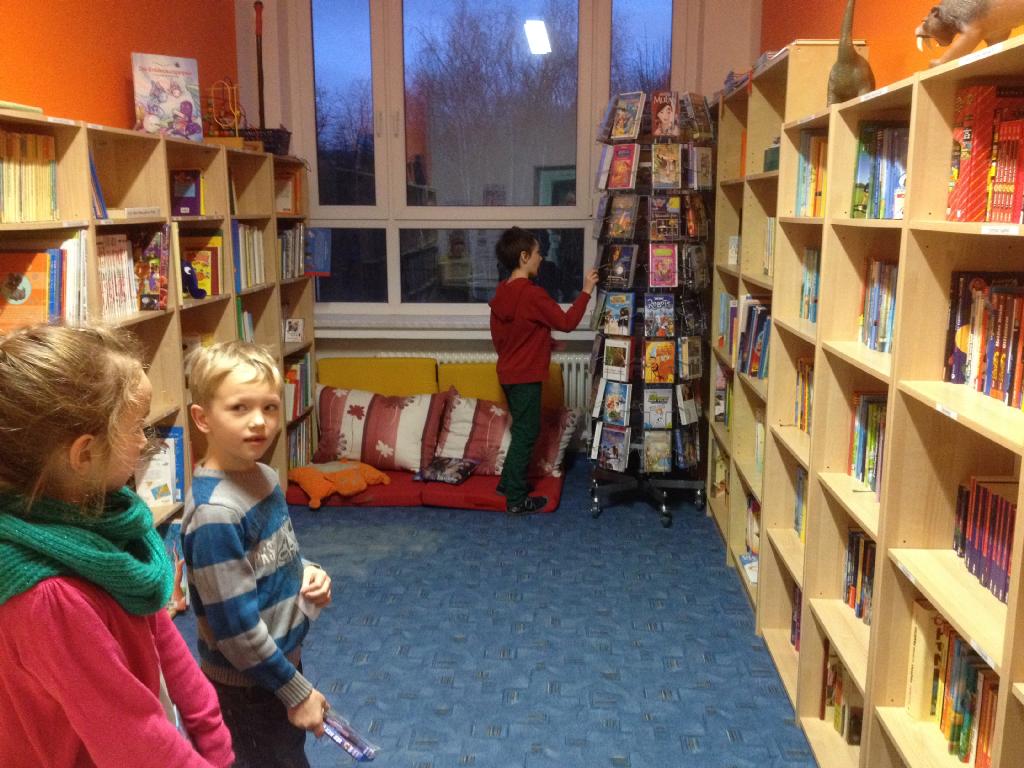
Schulinterne Lehrerfortbildungen, pädagogische Tage, Fortbildung
● Die Fortbildung der Lehrer trägt an unserer Schule einen hohen Stellenwert.
● Sie begünstigt die Professionalität der Lehrkräfte bei der Wahl der didaktischen Mittel, der Organisationsformen, der Unterrichtsmethoden und bei lernpsychologischen Themen.
● Die Fortbildungskonzeption analysiert den Bedarf und empfiehlt die geeigneten Fortbildungen.
● Die Auswahl der Inhalte der pädagogischen Tage orientiert sich an aktuellen pädagogischen bzw. unterrichtlichen Themen und wird vom Kollegium am Anfang des neuen Schuljahres festgelegt.
● Zur Entwicklung von Professionalität bei der Realisierung der erweiterten Bildungs- und Erziehungsziele, der politischen Bildung, der Medienbildung und Digitalisierung sowie der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, werden unsere Lehrerinnen die bereitgestellten Fortbildungsangebote aktiv nutzen und die gewonnenen Erkenntnisse und Kompetenzen weitergeben.
Pädagogischer Gesprächskreis (Teamtag)
● pädagogischer Gesprächskreis mit flexiblem Zeitrahmen und freiwilliger Teilnahme
● Festlegung der Themen durch Schulleitung oder einzelner Kollegen nach Bedarf
● verschiedenartige Inhalte (pädagogische Aspekte im Vordergrund oder organisatorische, Austausch von Informationen)
● Planungen, Vorhaben, Rückblicke, Feedback sind ebenfalls Gegenstand dieses Pädagogischen Gesprächskreises
ELTERNARBEIT
Ziele der Zusammenarbeit
● Wir streben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern und Schülern an.
● respektvoller, ehrlicher und offener Umgang miteinander, auch bei Konflikten
● Durchführung gemeinsamer Aktivitäten zur Förderung der direkten Kommunikation und der Gemeinschaft
● Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule durch gegenseitige klare Informationen ermöglichen
Schwerpunkte und Konkretisierungen der Zusammenarbeit
1. Elternabend zur Schulvorbereitung und Schuleinführung
● ein Jahr vor dem Schuleintritt Elternabend zur Vorbereitung der Schulanmeldung (Termine zur Schulaufnahmeuntersuchung, Ablauf der Kooperation Kita- Grundschule, Hinweise zur Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Schulanfängers)
● 0. Elternabend vor den Sommerferien (Bekanntgabe der Klassenbildung und – lehrer, Tipps für Eltern über gesunde Ernährung, sinnvolle Schulutensilien, über den Umgang mit Medien wie Computer, Fernsehen und vieles mehr, Vorstellung der gewählten Leselehrmethode)
2. Elternabend und Rückmeldungen
● zweimal im Schuljahr Elternabend, Ergänzung durch regelmäßig stattfindende Elterncafés, - stammtische u.ä., um über das Lernen in der Klasse und über Inhalte des Unterrichts zu informieren
● Elterngespräche ergänzen dies, individuell auf das eigene Kind abgestimmt
● Halbjahresinformationen und Zeugnisse geben Rückmeldungen über den Leistungs- und Entwicklungsstand der Kinder
● offene Kommunikation auf direktem Weg zwischen Klassenlehrer und Eltern erforderlich, um Probleme direkt anzusprechen und effektiv handeln zu können



3. Elternarbeit und Förderverein
● bei Schul- bzw. Sportfesten, Exkursionen, Wandertagen, dem jährlichen Schulgarteneinsatz im Herbst oder Klassenfahrten sind die Eltern als Unterstützung immer willkommen
● engagierte Eltern, HorterzieherInnen und LehrerInnen gründeten den Förderverein, um die konzeptionelle Arbeit an unserer Schule ideell und materiell zu unterstützen (Ausstattung der Klassen mit zusätzlichem Lernmaterial, ein grünes Klassenzimmer, Spielekörbe für die Hofpause usw. sowie die aktive Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen)
● enger Kontakt zwischen Verein, Eltern und dem Lehrerkollegium, um zukunftsweisende Projekte in Anlehnung an die pädagogischen Ziele der Schule mittragen zu können
Elternfeedback
Einmal im Jahr finden interne Evaluationen statt, bei der die Eltern direkt befragt werden. Dieses ermöglicht unserem Lehrerteam, Verbesserungen vorzunehmen und regt den Austausch an, denn die Meinung unserer Eltern in Bezug auf unsere Arbeit ist uns wichtig
ZUSAMMENARBEIT GRUNDSCHULE - HORT
Grundsätze unserer Zusammenarbeit
● Die Lehrer der Grundschule Radeberg-Süd und die Erzieher der Horte arbeiten konstruktiv zusammen, um jedem Kind einen interessanten und freudvollen Schulalltag zu ermöglichen.
● gemeinsame Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder durch Lehrer und Erzieher
● Gestaltung der Zusammenarbeit als gleichberechtigte Partner
● Abstimmungen, um die Herausforderungen gemeinsam zu lösen
● Achtung der Arbeit des Kooperationspartners
● voneinander lernen



Schwerpunkte der Zusammenarbeit
1. Kommunikation der Einrichtungen
● regelmäßige Gespräche zwischen Schulleitung und Hortleitung sowie Lehrern und Erziehern
● gegenseitige Besuche und Aktionen (Wandertage, Theaterbesuche…)
2. Vorschularbeit
● gemeinsame Planung, Durchführung, Nachbereitung der Veranstaltung
● Schnuppertage gemeinsam nutzen
● Tag der offenen Tür
● Teilnahme von Vertretern des Hortes zum 0. Elternabend
● bei der Schulanmeldung (2./3. Tag in der 1. Schulwoche) Hortgebäude offen
3. Elternarbeit
● Teilnahme am Elternabend bzw. Hortnachmittagen
● Teilnahme an Eltern-/Therapiegesprächen bei besonderen Kindern
4. Hausaufgabenbetreuung
● feste Hausaufgabenregeln (siehe Anlage) sind für alle Schüler und Erzieher verbindlich
● bei GTA- Besuch werden die Hausaufgaben zu Hause erledigt
5. Gemeinsame Nutzung ausgewählter Objekte
● Turnhalle (Vormittag = Unterricht, Nachmittag = Nutzung durch GTA und für Hortangebote)
● Gemeinsame Nutzung des Schulhofs und der Hortanlage während der Hofpause und Hortbetreuung
6. Reflexion
● gemeinsame Reflexion der Zusammenarbeit erfolgt im darauffolgenden Jahr durch die Schul- und Hortleitung
